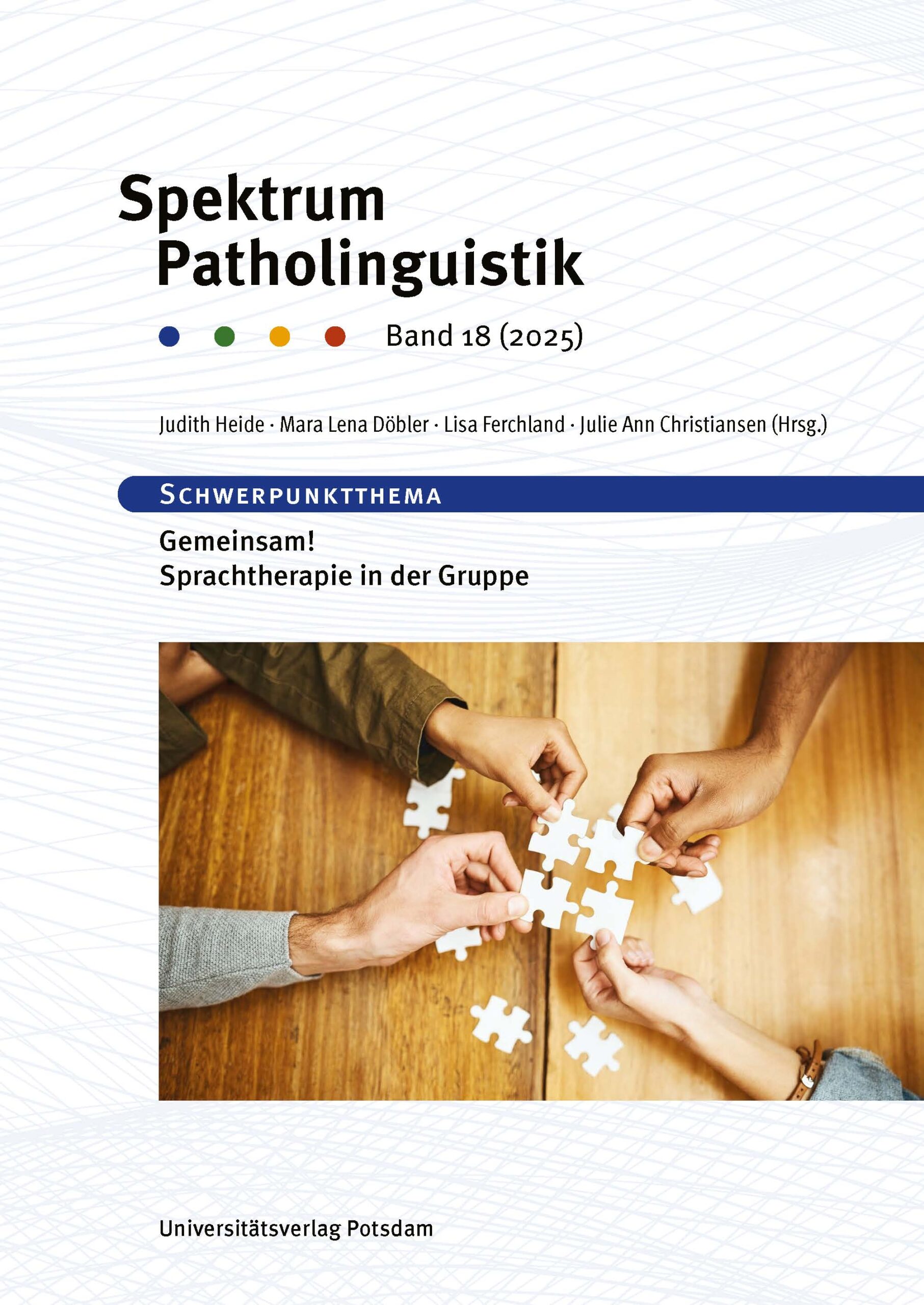Entwicklung von Blickbewegungen und Leseleistungen im Grundschulalter
Charlotta Hesse, Neitah Eckerlin, Michael Wahl & Katharina Weiland
Humboldt-Universität zu Berlin
Mithilfe von Eyetracking kann der Leseprozess in Echtzeit, damit auch Veränderungen der Blickbewegungen im Laufe des Leseerwerbs, abgebildet werden. Dabei zeigen Leseanfänger*innen üblicherweise längere Fixationen und kürzere Sakkaden, mit zunehmender Erfahrung nähern sich die Muster denjenigen kompetenter Leser*innen an. Bisherige Studien untersuchten Kinder meist nur querschnittlich; längsschnittliche Untersuchungen über mehrere Jahre fehlen im deutschsprachigen Raum.
Ziel dieser Arbeit ist es, die Entwicklung der Blickbewegungsparameter und Lesefähigkeiten beim lauten Lesen von Schüler*innen von der 1. bis zur 7. Klasse nachzuzeichnen. Zentrale Parameter sind dabei die Textlesedauer, Fixationsanzahl und -dauer sowie Häufigkeit und Amplituden progressiver/regressiver Sakkaden. Als Außenkriterium wird die Lesefähigkeit mit dem Lesetest aus dem Salzburger Lese- und Rechtschreibtest (SLRT-II; Moll & Landerl, 2014) ermittelt. Im Rahmen der vorliegenden Studie werden entsprechende längsschnittliche Daten von 18 Schüler*innen über die ersten sieben Schuljahre berichtet.
Die Ergebnisse zeigen, dass sich die Ausprägung der Blickbewegungsparameter – bei heterogener Ausgangslage der Leseleistungen am Ende von Klasse 1 – bis zum Ende der 4. Klasse denjenigen kompetenter Leser*innen wie erwartet annähert. Bei den folgenden Messzeitpunkten sind kaum noch Unterschiede auszumachen, die Werte stabilisieren sich. Dies wird vor dem Hintergrund effizienter(er) Lesestrategien diskutiert.